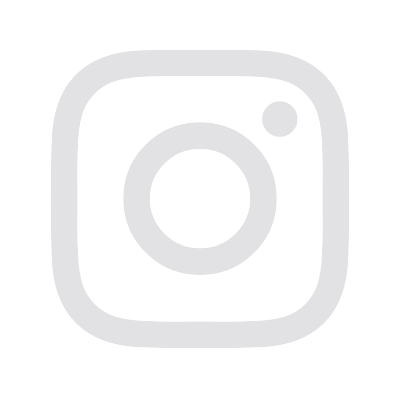Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.








Schauspiel von John von Düffel · Nach Sophokles, Euripides und Aischylos · Interlinear-Übersetzung von Gregor Schreiner
Schwäbisches Tagblatt, 2. Mai 2023
(von Peter Ertle)
John von Düffels „Orest“ in einer kompakten, stringenten Inszenierung am LTT.
Der Mensch ist dem Menschen – ein Wolf? Hier: Ja, gleich zu Anfang: Wolfsgeheul.
Dann rast Orest um die Säule in der Bühnenmitte wie in jenem Pferderennen, bei dem es ihn angeblich aus der Kurve trug und zerschmetterte, was der heimkehrende, als Bote verkleidete Orest seiner Mutter Klytaimnestra auftischen wird, um ihre vermutete Erleichterung als weiteres Beweismittel für ihre moralische Verkommenheit zu haben. Der Tod im Pferderennen – eine Lüge also, aber eine gute Metapher für ein anderes Rasen und Umkommen, jenes nämlich der Rache, die Orest umtreibt, samt dem darauf folgenden Rasen der Schuldgefühle, nachdem er seine Eltern tötet.
„Wer Schlechtes tut, dem geht es schlecht“, wird Menelaos später lakonisch kommentieren. Ganz am Schluss des Stücks wird dieser Satz noch einmal auftauchen, in diesem Menetekel aus Sätzen, die ein anderes Ende hätten bringen können, wären sie nur befolgt worden. Aber hier, in John von Düffels sich auf drei antike Dramen berufendem Stück, gibt es, anders als bei Euripides oder Ayschylos, weder ein Gericht der Götter noch einen Polis-Beschluss, der weiter blickt und verzeiht. Hier gibt es nur Hass auf Hass, stets trifft die schlimmste, düsterste Variante ein. Eine beliebte Dramaturgie, von Heiner Müller bis Games of Thrones. Die Untröstlichkeit hat einen Vorteil: Sie kann nicht mehr enttäuscht werden. In diesem Fall mag sie als kathartisches Negativ noch zu einem Positiv-Appell an die Zuschauer taugen.
Der Autor hat die verfluchte Familie fokussiert, Regisseur Dominik Günther beziehungsweise die seine Inszenierungen immer ausstattende Sandra Fox setzt sie in ein Stallgitter, Knast, Sparringsbezirk, ein Nest mit böser Brut auf einen Turm oder einer griechischen Stele. Klytaimnestra (Sabine Weithöner) und Aigistos (Andreas Guglielmetti), die übermächtigen Eltern als säulenheilige Geier, zwischen den Nesthäkchen Elektra (Jennifer Kornprobst) und Chrysotemis (Julia Staufer) wird schnell klar, wer die Stärkere ist, die Radikalere: Elektra. Orest, der Bruder (Lucas Riedle), ist viel anfechtbarer. Unter falscher Identität – hier tut’s ein vorgehaltenes Pappgesicht – spricht er mit Muttern und kommt emotional sofort ins Schlingern, als die überraschend bekundet, sie habe ihren Sohn zwar ob seiner Rachepläne, von denen auch sie erfuhr, gefürchtet, doch immer vermisst, geliebt.
Die Ursache für den Hass ihrer Kinder auf sie und ihren neuen Mann stellt Klytaimnestra ganz anders dar, als die Kinder es sehen: Befreiung von einem Unmenschen sei der Mord an ihrem Ex Agamemnon gewesen, der habe schließlich die erste Tochter Iphigenie de,n Göttern sprich der Karriere geopfert. Sabine Weithöner spricht’s, als Mutter alles überstrahlend, von ihr geht tatsächlich ein Bann aus, und genau jene Ambivalenz aus Zwielichtigkeit und Vertrauen, Härte und Weichheit, die dieser Figur zuträglich ist – und auch der Wahrheit der Story: Denn inwieweit Klytaimnestra authentisch ist oder sich herausredet beziehungsweise ihre Version eben längst verinnerlicht hat – dieser nicht mehr vollständig zu entwirrende Perspektivismus liegt nicht nur im Nebel der Mythologie, er ist auch sehr realistisch, sobald man in Familiensituationen (oder Weltsituationen) schaut.
Was die Akteure im und um den Turm herum fabrizieren, ist dabei so sprechend wie ansprechend. Ob ein halb am Gitter hängendes Pas de deux zwischen Elektra und Orest, später die in Sack und Asche gehende Gewissensqual des Bruders, oder jenes mit dem Kopf durch die Wand beziehungsweise übers Gitter Wollen Elektras, die vor lauter Wut die Tür nicht sieht – ein treffliches Bild ihrer Persönlichkeit.
Und sehr körperlich alles, ein Pendant zum antik-schriftsprachig gehaltenen Text. Alles andere als ein Konversationsstück. Dafür sorgt auch die selten, dann aber wuchtig eingesetzte Musik, zum ersten Mal als musikalische Amphetaminrausch-Afterworkparty nach dem Mord, rockig im wild flackernden Discolicht, Feuerwerk im sonst graumetallischen (Mono-) Ton.
Farbe kommt auch rein, als Menelaos (Andreas Guglielmetti) und sein schönes Web Helena (Sabine Weithöner) samt ebenso schillernder Tochter Hermione (Julia Staufer) als Luxus-jetsettende Malle-Urlauber die Bühne betreten und man sich fragt, wieso die ins Stück mitreingenommen wurden, käme das Treiben doch auch ohne sie aus.
Doch dann kommt einem diese Familie doch bekannt vor: Ist das nicht unsere mit allerlei Verbrechen unsichtbar versippschaftete Wohlstandswelt, unsere Entfernung, unsere Gelassenheit, was tatsächlich ein Ausweg wäre, für alle, die es sich leisten können. Doch in diesem gnadenlosen Stück, man ahnt es, schützt auch kein Tourismus als Zweitrolle, werden auch diese hereinschneienden Besucher gemetzelt. Von Orest, dessen erschrockene Augen, dessen immerwährender Kampf zwischen Besinnung und hingerissener Tat ein so bleibendes Moment dieser Inszenierung sind wie Elektras RAF-taugliche Entschlossenheit und Kälte – während sie ihrem Bruder gegenüber ein großes Herz hat, ach, auch sie: eine Liebende!
Gern würde man ihnen über den Kopf streichen und sagen: „Lasst! Lasst! Alles wird gut.“ Doch der Wind, der von Zorn und Hass ausgeht, ist stärker. Wird also weiterblasen. So einfach sind die weisen, gut gemeinten, am Ende des Stücks nochmal umhergeisternden Ratschläge halt nicht zu befolgen, im Konfliktfall, wenn man sich ungerecht behandelt, gedemütigt, verletzt fühlt. Und so siegt hier nicht die Vernunft, sondern der Fluch, das in eine Zeitlupentrance gegossene Weiterrrasen und Toben der Vergeltung. Wahrscheinlich, bis ihm irgendwann die Kraft ausgeht. Ist das jetzt auch – ein Zeitkommentar?
Unterm Strich
Auf dieser Familie lastet ein Fluch, und in John von Düffels auf der Mythologie und der Bearbeitung griechischer Dramatiker beruhenden Fassung ist auch kein Ende abzusehen, da weder Götter noch Vernunft ein entscheidendes Gewicht mehr darstellen. Eine sehr dichte, körperliche, so klare wie dunkle Inszenierung mit starken Bildern.
Reutlinger Generalanzeiger, 2. Mai 2023
(von Thomas Morawitzky)
Dominik Günther setzt John von Düffels »Orest« am LTT bedrohlich grau und auf engem Raum in Szene
»Wer Schlechtes tut, dem geht es schlecht« – eine überaus simple Moral ist es, die John von Düffel den Zuschauern am Ende seines »Orest« ans Herz legt. Ganz klar: Auf böse Tat soll Strafe folgen, selber schuld. Orest und Elektra allerdings sind nur zwei Glieder in der Kette des Mordens: Vater Agamemnon wütete im Trojanischen Krieg; die Mutter Klytaimnestra tötete gemeinsam mit ihrem Liebhaber Aigisthos den Vater. Nun will Elektra, die Schwester, dass Orest den Vater rächt. Klytaimnestra und Aigisthos bleiben nicht die letzten Opfer: Ein Blutbad beginnt.
John von Düffel hat für sein Stück auf antike Vorlagen zurückgegriffen, sie zusammengeführt, sich bedient bei Sophokles, Euripides, Aischylos. Die Handlung, die von Düffel so konstruiert hat, wirkt straff – Orest streut das Gerücht seines Todes, kehrt unerkannt heim, erschlägt die Mutter und ihren Liebhaber, wird schuldig: Muttermord galt der Antike als schlimmstes Verbrechen. Kein Gott ist es, der Orest den Mord befielt, er allein trägt die Verantwortung. Was aus den Geschwistern wird lässt John von Düffel offen – ihn interessieren die Konstellation, der Konflikt.
In ihrer Verdichtung lässt die Tragödie viele Deutungen zu – und Dominik Günther, der John von Düffels »Orest« in der Werkstatt des LTT inszeniert hat, lässt sie offen. Ein Sprung findet statt, als Andreas Guglielmetti in der Rolle des Menelaos auftritt – da spaziert ein unangenehm heiterer Tourist auf die Bühne, beansprucht allen Platz für sich und seine sechs Hartschalenkoffer. Die angetraute schöne Helena (Sabine Weithöner) entpuppt sich als versnobte Sonnenbrillenträgerin, geradewegs einem Lifestyle-Magazin entsprungen. Orests Mordlust scheint plötzlich fast schon nachvollziehbar.
Zuvor jedoch gibt sich das Stück streng, ganz grau, ganz reduziert. Die Bühne (Sandra Fox) ist kleine Plattform nur, ein Käfig, von Drahtzaun eingeschlossen. Die Schwestern Elektra (Jennifer Kornprobst) und Chrysotemis (Julia Staufer) toben in den grauen Kissen, die den Käfig füllen, imitieren das geile Grunzen, mit dem sich die Mutter und der Vatermörder paaren. Klytaimnestra und Aigisthos selbst – Guglielmetti und Weithöner in Doppelrollen – stehen regungslos in Nischen hinterm Drahtverschlag. Orest derweil umkreist dieses Sinnbild einer gewaltsam verkapselten Familie, möchte ein Wolf sein, heult wie einer.
Wie Lucas Riedle sich als Orest unerkannt dem Kreis seiner Familie nähert, sich schließlich Elektra zu erkennen gibt, mit verschlagenem Grinsen hinter einer Maske hervor oder aus seinem grauen Hoodie heraus schaut, ist eindrucksvoll gespielt; Jennifer Kornprobst tobt dazu im Techno-Exzess, feuert den Bruder an: »Sterben muss sie. Eine Wölfin ist sie. Ein Wolf der Wölfin!« Und sie heulen gemeinsam. Gewalt ballt sich zusammen. Spürbar.
Die klaustrophobische Stimmung, die das Stück aufbaut, die lauernde Gewalt, sie wirken stark, bedrohlich, ausweglos. Als Orest auf Klytaimnestra trifft, stehen Schweigen, Vorwürfe, Hass im Raum. Orest zögert, wird den Mord aber doch begehen. Der antike Stoff gewinnt in John von Düffels Bearbeitung erstaunliche Frische – schade nur, dass die Moral, die er bietet, so überaus pauschal wirkt.
nachtkritik.de, 30. April 2023
(von Thomas Rothschild)
Kammerspiel – mit Lust am Effekt
Orest rennt. Er rennt im Kreis, stolpert auch, nicht nur, weil das zurzeit auf deutschen Bühnen en vogue ist, sondern weil er offenbar verfolgt wird. Elektronische Musik ersetzt das Bellen der wütenden Hunde der Rache.
Die Redaktion ist streng. Wie findet man das richtige Maß zwischen Kenntnissen, die man bei den Leser*innen voraussetzen zu dürfen meint, und Informationen, die zu verweigern arrogant wäre? Ist es eine Banalität oder eine Mitteilung, dass die Orestie zu den bedeutendsten Stoffen der Weltliteratur gehört? Alle drei großen Dramatiker der griechischen Antike, Aischylos, Sophokles und Euripides, haben ihn, unter unterschiedlichen Titeln und Perspektiven und jeder auf seine Art, auf die Bühne gebracht. John von Düffel, erfahren in der Bearbeitung kanonisierter dramatischer und epischer Werke, hat vor zehn Jahren eine synkretistische Fassung der Orest-Plots verfasst und diese dabei in sein eigenes Universum übertragen, das, wie man auch aus seinen anderen Adaptionen weiß, eher durch Demut gegenüber den Vorlagen als durch Originalitätseifer gekennzeichnet ist.
Mit den Überschreibern jüngeren Datums hat John von Düffel wenig gemeinsam. Dass er Anachronismen nicht scheut, bezeugt schon der Titel des ersten Teils: "Die Psychologie des Entschlusses". Das Wort "Psychologie", wenn nicht gar, was es bezeichnet, kam erst im 16. Jahrhundert auf. Jetzt hat Oberspielleiter Dominik Günther "Orest" im Landestheater Tübingen einstudiert.
Von Düffel beschränkt das Personal auf acht Rollen, von denen sechs auf drei Darsteller verteilt sind. Nur Orest und Elektra sind nicht als Doppelrollen konzipiert und bilden somit das Zentrum der Fabel. Agamemnon tritt bei von Düffel ebenso wenig auf wie Pylades, Kassandra, Apollon oder Pallas Athene. Von den Göttern ist zwar die Rede, Orest beruft sich auf sie und Elektra fleht die Eumeniden an, aber die Bühne überlassen sie in unserer säkularisierten Gegenwart den Menschen. Damit positioniert sich John von Düffel in diametralem Gegensatz zu den monumentalen Inszenierungen der "Orestie" von Peter Stein und, unter dem Titel "Die Atriden", von Ariane Mnouchkine, die nun einmal für die europäische Theatergeschichte der vergangenen Jahrzehnte Maßstäbe gesetzt haben. Auch die Lesart, welche die "Orestie" als politisches Drama über die Einführung der Gerichtsbarkeit im antiken Griechenland begreift, spielt bei von Düffel keine Rolle und beraubt somit Athene ihrer Funktion. Der fast kammerspielartige Charakter seiner auf 90 Minuten komprimierten Trilogie rechtfertigt zudem die Tübinger Entscheidung, "Orest" in der intimen Werkstatt des LTT aufzuführen.
Sandra Fox hat ein mit Maschendraht vergittertes, mit Müllsäcken gefülltes Hexagon auf ein Podest gestellt. Es steckt, in Übereinstimmung mit den Kostümen buchstäblich Grau in Grau, die Spielfläche ab. Klytaimnestra und Aigisthos stehen wie Statuen im Hintergrund. Wenn Orest, der später die Position von Aigisthos einnimmt, unerkannt bleiben soll, hält er sich eine Stabmaske vor's Gesicht.
Jennifer Kornprobst ist Elektra. Sie krümmt sich, zuckt, wirkt in einem fort exaltiert. Die Psychologie vergangener Zeiten hätte ihr vielleicht Hysterie diagnostiziert. Damit ist sie der Elektra von Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauß näher als dem antiken Modell, dessen Mordlust wohl begründet, also zwar nicht entschuldbar, aber verständlich ist. Wie eine Wahnsinnige wiederholt sie das Wort "Besonnenheit", das ihr ihre Schwester Chrysotemis (Julia Staufer) abverlangt. Die Regie tut ein Übriges. Wenn der verkleidete Orest (Lucas Riedle) von sich selbst erzählt, dass er "stürzt", dann stürzt er. Immer wieder krankt der Abend an gestischer Überdeutlichkeit, als dürfte man nicht zu sehr auf die Rede vertrauen. Nur Sabine Weithöners Klytaimnestra bewegt sich wie in Zeitlupe. Dafür darf sie später als Helena das Divenklischee mit Shawl und Sonnenbrille bedienen. Jackie Kennedy Onassis? Elektra wiederum und Orest tanzen im Blutrausch einen Sirtaki. So sind sie halt, die Griechen.
Im dritten Teil – "Der Wahnsinn danach" – verwandelt sich das Einheitsbühnenbild in eine Mischung aus Disco und Guantanamo. Orest ist in einem Ganzkörpersack verfangen. Die Regie kann nicht genug von dem Effekt kriegen und verliert das Gefühl für Rhythmus. Dann tritt Menelaos (Andreas Guglielmetti) als Touristenkarikatur mit sechs Alukoffern auf. Da schrammt die Orestie an der Komödie vorbei. Aber John von Düffel ist nicht Jacques Offenbach. Oder haben wir etwas übersehen? "Wer Schlechtes tut, dem geht es schlecht", mahnt Menelaos. Da hat er recht. In der Orestie und darüber hinaus.