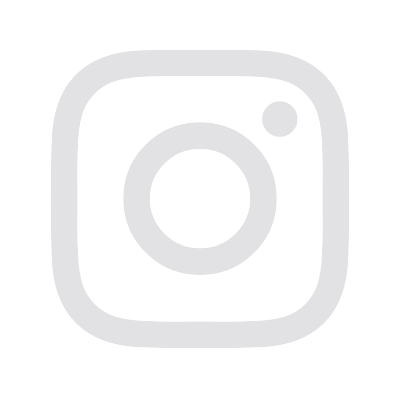Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.














Ein Familiengemälde in einem fürstlichen Hause von Friedrich Schiller · 14+
Schwäbisches Tagblatt, 30. September 2024
Der kluge Philanthrop im Wahn der Zeit
(von Peter Ertle)
Wenn Regisseurin Sophia Aurich und Bühnenbildnerin Martina Pinsker zusammenarbeiten, kann man sich auf ein spannendes, vielgestaltig verschachteltes und verschiebbares Bühnenbildhaus einstellen, dessen Innenleben teils in verwirrenden Brechungen per Kamera nach außen projiziert wird. So war es bei „Das große Heft“. So ist es nun wieder bei Schillers Don Karlos.
Im „Don Karlos“ läge wohl auch eine aktuelle Botschaft, die ist vor lauter privaten Liebes- und Machtspielchen aber recht verstellt. Doch vielleicht liegt ja gerade darin eine gewisse Aktualität.
Wenn Regisseurin Sophia Aurich und Bühnenbildnerin Martina Pinsker zusammenarbeiten, kann man sich auf ein spannendes, vielgestaltig verschachteltes und verschiebbares Bühnenbildhaus einstellen, dessen Innenleben teils in verwirrenden Brechungen per Kamera nach außen projiziert wird. So war es bei „Das große Heft“. So ist es nun wieder bei Schillers Don Karlos. Die Live-Kamera und ihr Film sind hier allgegenwärtig, Zeichen von Misstrauen und gegenseitiger Überwachung.
Die Komplexität der Intrigen, Rivalitäten, Freundschaften, offenen und heimlichen Liebesbeziehungen oder auch mal nur Liebeserwartungen – ist hoch in diesem Stück. Wenn zur Pause ein paar Zuschauer rausgehen und sich fragen, warum das im Theater immer so gemacht werden muss, dass man es nicht versteht (sorry, ja, wir haben gelauscht), dann müsste man ihnen in diesem Fall entgegnen, dass es ausnahmsweise mal nicht an der Regie, sondern in erster Linie an Friedrich Schiller liegt.
Wobei es so losgeht, wie es der Bühnenauftrag an Schiller erst mal vorsah, bevor der über viele Jahre immer wieder daran bastelnde Autor mehr draus machte als das bestellte Liebesdrama. Lucas Riedles blöderweise in seine Ex-Verlobte und heutige Mutter (ja, das Leben!) verliebter Infant will endlich ganz Mann und am liebsten Heeresführer sein, ein zappelig verträumter Möchtegern mit leuchtenden Augen.
Auch Marquis von Posa, sein Jugendfreund, will ihn als Helden, wenn auch aus anderen, reiferen, aufklärerisch-idealistischen und politisch gegensätzlichen Motiven heraus. Er will Karlos zum Anführer des flandrischen Aufstands gegen Philipps Krone machen.
Dass Posa und Karlos Freunde sind, passt von ihren ganzen Wesenszügen her so gar nicht. Als einzige Erklärung bliebe, was in dieser Inszenierung nie explizit, aber unterschwellig angedeutet wird: die Möglichkeit einer gewissen homoerotischen Anziehung. Dass Königin Elisabeth (Insa Jebens) in früheren Zeiten die Dritte in diesem idealistisch beseelten Sturm- und Drang- Bunde war, wird nicht so recht klar. So bleibt das Drama lange eines von verschiedenen heimlichen Lieben. Wer immer diese Heimlichkeiten entdeckt, benutzt sie sogleich als Machtinstrument für die eigenen Zwecke.
Muss uns das interessieren? Nein. Können wir der zunehmenden Verwirrung in diesem Ränkespiel folgen? Gerade noch so. Oder auch nicht. Rechts schläft jemand ein. Der Platz links bleibt nach der Pause leer. Sehr spät erst werden in diesem Stück die privaten Beziehungen mit einem gesellschaftspolitischen Hintergrund aufgeladen. In ein paar Dialogen zwischen Karlos und Posa, im Pingpong (ja, sie spielen Federball!) zwischen Posa und Elisabeth. Und dann, ja, dort wirklich und großartig gespielt von beiden Schauspielern, im zentralen Dialog um die berühmte Textstelle herum: „Sir, geben Sie Gedankenfreiheit!“
Jürgen Herolds Marquis von Posa gelassen, souverän, mit Verständnis für den Regenten, aber doch klar in seiner Haltung. Rolf Kindermann lässt seinen Philipp staunen, Sympathie für den Posa empfinden, der Sache aber irgendwie auch nicht ganz trauen, hin- und hergerissen. „Ich glaub, so einen Menschen hab ich überhaupt noch nie gesehen“, murmelt er. Solch kleine Einschübe im heutigen Sprech sind schön und wiederholt. „Ich hab grad eine schwierige Phase“, vertraut Don Karlos seinem Freund Posa an. Herzog von Alba, den Solveig Eger als kantig-lässigen Manspreadingtypen gibt, ruft beim Lesen eines dieser heimlichen brieflichen Liebesergüsse aus: „Was für ne gequirlte Sturm- und Drangscheiße“.
Schön choreographiert ist das Necken zwischen Philipp und der Prinzessin von Eboli (Robi Tissi Graf), das Bühnenrund mit verschiedenen Türen eröffnet da einige Möglichkeiten. Und Elisabeth, die stärkste Figur in dieser Inszenierung, lässt Beichtvater Domingo und Alba wunderbar auflaufen.
Nach der Pause werden alle Personen des Stücks im offenen Tableau eines großen Festgelages präsentiert, das sich erst allmählich aus dem Nebel schält. Das ist schon einiges fürs Auge, inzwischen sind auch die Konfliktlinien zwischen den Figuren in ihrer Dramatik schärfer.
Trotzdem fehlt irgendetwas, ein Bogen zu heute. Was ist das mit diesem flandrischen Freiheitskampf? Wo ist dieser Kampf um Freiheit heute? Was wäre das überhaupt, Freiheit? Welche Freiheit? Und wo führt sie hin? Die Inszenierung muss das gespürt haben. Und antwortet mit neuen Textteilen, deren Herkunft im Programmheft zu vermerken redlich gewesen wäre. Einmal geht’s um die freiheitsverhindernde Idee der Frau als Liebesobjekt. Schön zwar, aber ins falsche Stück verirrt beziehungsweise bei unübersehbar vielen als feministischer Kommentar denkbar.
Dann, am Ende, als die Stunde der Inquisition schlägt (ganz stark Gilbert Mieroph), gibt es einen Beitrag zum Umschlagen des Freiheitsdrangs in die Sehnsucht nach Ruhe, Ordnung, Sicherheit und einigermaßen Wohlstand, jenen Zustand, für den so viele die freiwillige Versklavung vorziehen. Da sind wir im Hier und Heute beziehungsweise erst gestern gelandet, in einem eingespielten Film marschieren Soldaten. Wirkt wie ein Nachklapp-Kommentar.
Jedenfalls: Posa lässt sich am Ende für die gute Sache erschießen. Schiller kommentiert das mit einem „Aufopferungsfähigkeit ist der Inbegriff aller republikanischen Tugend“. Ersetzt man das martialische Wort von der Selbstaufopferung mal mit „Absehen von sich selbst, Engagement für andere“, wird ein Schuh draus. In einer Welt, in der von Philipp, Eboli, Carlos, Alba bis Domingo alle nur ihre Macht-, Liebes-, Ehrgeiz- und Karrieredinge verfolgen, ruht nur Elisabeth in sich, wenn auch noch unbefreit von der Rollenerwartung ihres Jahrhunderts. Auch Philipp kann und will nicht aus seiner Haut, obwohl ihm bereits unwohl ist. Wahrhaft frei, arbeitend an einer neuen Zeit, ist allein Posa. Die Posas sind heute wieder die meistgehassten Menschen. So ist das.
Unterm Strich
Wieder ein tolles, vielgestaltiges Bühnenbild. Dass die Handlung unübersichtlich ist, geht aufs Konto von Friedrich Schiller. Der aktuelle Bezug zum heute überall bemühten Wort „Freiheit“ wird nicht recht akzentuiert, weshalb hier auf zwei Texteinschübe jenseits des Don Karlos zurückgegriffen wird.
Reutlinger General-Anzeiger, 30. September 2024
Wie war das noch mit Sturm und Drang? Schillers »Don Karlos« am LTT
(von Thomas Morawitzky)
»Don Karlos« ist, im großen Saal des LTT und mit einer Spielzeit von gut drei Stunden, ein fordernder Einstieg in die neue Spielzeit, [...] dank der konzentrierten Regie und der wunderbaren Schauspieler aber sehenswert und spannend bis zuletzt.
Das Landestheater Tübingen spielt Friedrich Schillers »Don Karlos« in einer Inszenierung der Berliner Regisseurin Sophia Aurich. Diese bricht den historischen Rahmen des Stücks immer wieder komisch und trocken auf.
Das königliche Schloss Aranjuez ist auf der Bühne des Landestheaters Tübingen ein großer, dunkler Metall-Silo, noch geschlossen, über den Bildern hinweghuschen, Gesichter, Stimmen. Das Bühnenbild, das Martha Pinsker für Friedrich Schillers »Don Karlos« schuf, ist ambivalent, von Anbeginn: Das schwere Metallgehäuse wird sich drehen, öffnen, das Innere des Palastes preisgeben; es wird sich wieder schließen, und König Philipp II. sitzt dann obenauf, ein unnahbarer Herrscher. Zur Seite stehen Palmen, wie ausgeschnitten. Ein Licht lässt diesen Bau zu einem tiefblau schimmernden Märchenschloss werden, ein anderes zu einem Käfig, einem dunklen und bedrohlichen Monument.
Das Sounddesign tut das Seinige: Hier türmt sich elektronischer Klang mit dramatischer Wucht auf, gibt vielen Szenen einen latent bedrohlichen Charakter. Tritt der Herzog von Alba auf, scheinen dunkle, rhythmische Schläge Gefahr zu signalisieren. Friederike Bernhardt und Johannes Cotta kreierten den sinistren Soundtrack, der dem Spiel viel Kraft gibt, einige Zuschauer jedoch abschreckt: Vor der Bühne wird mitunter darüber geklagt, die Dialoge seien nicht zu verstehen.
Don Karlos erscheint als erster vor dem Schloss, mit ihm Domingo, Beichtvater des Königs, Vertreter der Inquisition. Don Karlos hat ein Problem, das man groß nennen könnte, wären die Probleme des Königreichs nicht tausendmal größer: Er ist verliebt. Und zwar in seine Mutter. Das ist weit weniger ödipal, als es klingt, handelt es sich doch um seine Stiefmutter. Als Karlos für Elisabeth von Valois entflammte, war sie noch unverheiratet, nun gehört sie seinem Vater, aber die Gefühle des Sohnes haben sich nicht geändert. Es entspinnt sich ein Versteckspiel, ein Hin und Her der kompromittierenden Briefe, der Intrigen.
Lucas Riedle spielt den Don Karlos vollkommen jugendlich, hitzig, ungestüm und unvorbereitet auf die Rolle, die ihn politisch erwartet; Rolf Kindermann, als sein Gegenpart, der König, Vater, wirkt oft unwirsch, getrieben, verbittert, Insa Jebens als Königin klar und bestimmt. Der Marquis von Posa, Don Karlos' idealistischer Jugendfreund, wird von Jürgen Herold gespielt; die Beziehung zwischen beiden scheint eng, fast erotisch aufgeladen. Gilbert Mieroph, ein Kruzifix auf seiner Wange, umkreist als Domingo das Geschehen. Robi Tissi Graf spielt die Prinzessin von Eboli als arglose Intrigantin, die zuletzt vor der Katastrophe, die sie heraufbeschwor, erschrickt. Und Solveig Eger als Alba ist immerzu höfisch und vielleicht gefährlich.
Friedrich Schillers Drama schildert zwischenmenschliche Konflikte vor historisch bedeutsamer Kulisse und fragt natürlich danach, wie das eine sich im anderen abbildet. Sophia Aurichs Tübinger Inszenierung fragt zudem, schon fast zurückhaltend, danach, wie Gegenwart und Geschichte sich zueinander verhalten, welche Schatten hier in die Zukunft geworfen werden. Erst zuletzt rücken die großen Zusammenhänge in den Mittelpunkt, und das Spiel endet, wiederum als Projektion, mit den Bildern von Truppen, Stahlhelmen, einem Weltkriegsszenario des 20. Jahrhunderts.
Don Karlos – die Geschichtsstunde ist im Programmheft enthalten – spielt im Jahr 1568; Philipp II., König von Spanien, ist der mächtigste Mann der Welt, über seinem Reich geht die Sonne nicht unter, aber es wird bald zerbrechen. Schiller schrieb das Stück rund 200 Jahre später, am Vorabend der Französischen Revolution; der Marquis von Posa ist ein Agent der Veränderung, spricht vom Ende der Monarchie, könnte Schillers Sprachrohr sein.
Schillers Text wird sehr dramatisch und genau gespielt, die Figuren in ihrer Leidenschaft und ihrem Ringen ganz ernst genommen – aber dennoch bricht Sophia Aurich den historischen Rahmen immer wieder komisch und trocken auf – da stimmt Prinzessin Eboli einen Popsong an, setzt sich dann auf die Bühne, um sich eine Zigarette zu drehen, da schimpft ein Darsteller plötzlich, vom Drama geplagt, los: »Dieser ganze Sturm-und-Drang-Scheiß!« Ein Brief, den Rolf Kindermann entrollt, weit oben, ist ein langes, weißes Laken, und Insa Jebens, die Königin, sucht nicht nur einmal verzweifelt nach ihrer Perlenperücke, sondern zitiert, sich fleißig schminkend, wiederum auf den geschlossenen Silo projiziert, einen Text der britischen feministischen Bloggerin Laurie Penny, die scharf kritisiert, wie die Liebe, als Begriff, instrumentalisiert, gefoltert und getötet werde.
Zuletzt ist das Innere des Schlosses eine verwüstete Partyzone, tragen die Spieler Hütchen, hängen Luftballons in der Luft. Aber die Party, natürlich, ist vorbei. »Don Karlos« ist, im großen Saal des LTT und mit einer Spielzeit von gut drei Stunden, ein fordernder Einstieg in die neue Spielzeit, schwer durchschaubar, finster und bedeutsam, dank der konzentrierten Regie und der wunderbaren Schauspieler aber sehenswert und spannend bis zuletzt.