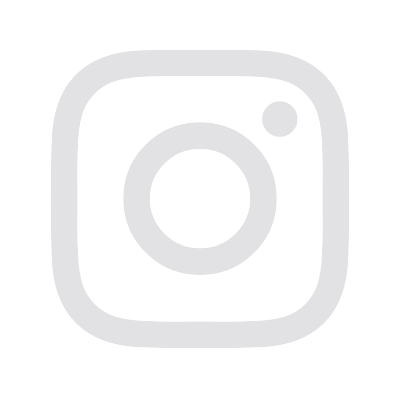Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.







Anti-Stück von Eugène Ionesco
Schwarzwälder Bote, 23. Juni 2021
Komödiantisch-schönes Theater voller Vitalität
(von Christoph Holbein)
Ionescos »Die kahle Sängerin« in Tübingen ist rundum gelungen.
Reutlinger General-Anzeiger, 21. Juni 2021
(von Thomas Morawitzky)
In Eugène Ionescos »Die kahle Sängerin« auf der LTT-Hofbühne treiben Logik und Sprache absurde Blüten.
Aus Metall scheint die Bühne zu bestehen, die Vinzenz Hegemann für »Die kahle Sängerin« schuf – auf dem Bretterboden vor dieser rostigen Kulisse stehen sechs Stühle; in einem schmalen Durchgang nach hinten schwingt ein übergroßes Pendel hin und her, ein Teekännchen steht auf einem alten Ofen, dessen Abdeckung lose herabhängt. Und sie treten auf: Mr. und Mrs. Smith, Gilbert Mieroph und Andreas Guglielmetti, sind plötzlich da und bringen den Punk mit, schreien als ausgeflippte Bürger dem Publikum das »No Future« der Sex Pistols ins Gesicht, kreischen was von englischen Sesseln, Living Rooms, englischen Pfeifen, aggressiv, böse und heiter.
Die Uhr hinter der Kulisse schlägt viele Male. Gleich werden die Smiths zurückkehren auf die Bühne, in ganz anderer Fasson. Sie bewegen sich trippelnd, robbend, hüpfen voran, in einer Parodie gesitteter Bürgerlichkeit, vor allem aber, weil sie statt Schuhen quadratische Filzlappen tragen, groß wie Fußmatten, die ihnen nichts anderes gestatten. Mieroph trägt eine vergilbte Zeitung am ausgestreckten Arm mit sich herum; Guglielmetti steckt in einem jener haferschleimfarbenen Kostüme für Damen aus besseren Verhältnissen, macht, zwischen zwei leuchtenden Ohrringen, eine große weiße Einkaufstasche vor sich hertragend, das rechte Gesicht dazu.
Das seltsame Paar hat sehr gut gegessen: »Weil wir in der Umgebung von Looondon wohnen und weil unser Name Smith ist.« Es nimmt mit großem Abstand voneinander Platz; sie redet von Öl und Kartoffeln, er lässt ein halbmenschliches Knirschen hören, den Arm noch immer krampfhaft ausgestreckt. Man gibt Banalitäten von sich, man macht Konversation, alles ohne Sinn, alles immer wieder. »Mein kleines Brathühnchen, warum spuckst du Feuer?«
Immer wieder mal schlägt auch die Uhr, die Zeit vergeht, Menschen sterben (»Er war der schönste Leichnam von Großbritannien … Und wie fröhlich er war!«), ganze Familien tragen denselben Vornamen (Bobby), und Joghurt, ganz wichtig, ist gut für die Apotheose, also die Verherrlichung eines Sterblichen zum Gott oder Halbgott.
Das Dienstmädchen Mary, gespielt von Jürgen Herold, viel zu groß und wenig feminin, erscheint und tanzt mit der Uhr, sabbert, kreischt und kichert, erbricht Milch, oder Joghurt. Später wird es seinen Dienstherren ein schmutziges Ständchen singen: »This Is Not A Love Song.«
Zum Tee, der nicht getrunken wird, kommen Mr. und Mrs. Martin, erst mit US-amerikanischen, dann mit französischem Akzent – jüngere Duplikate von Mr. und Mrs. Smith, sie im selben Kostüm, er in derselben Weste, nur mit Brille. Susanne Weckerle und Sabine Weithöner spielen dieses Paar. »Should I Stay Or Should I Go« – das ist ihr Song.
Wenig später wird es an der Tür klingeln, Mrs. Smith wird mehrfach auf ihren Filzmatten dorthin schleichen und niemanden finden. Dann steht plötzlich der Feuerwehrhauptmann (Stephan Weber) im Raum, in leuchtend blauer Uniform, mit einem silberglänzenden Helm auf dem Kopf, nichts als Fleiß und Freude im Gesicht, schaut erst noch am Pendel vorbei, ehe er ganz hereintritt – ein sensationeller Auftritt, der das Publikum gleich auflachen lässt.
Eugène Ionesco, ein Begründer des Absurden Theaters, schrieb »Die kahle Sängerin« 1950; aufgeführt wurde das Stück noch vor Becketts »Warten auf Godot«, bis heute ist es ein moderner Klassiker, der schiere Sinnlosigkeit und Sprachakrobatik in unwahrscheinliche Höhen schraubt. Dass Zuschauer sein Stück zum Schreien komisch fanden – sie tun es noch – soll Ionesco sehr verwundert haben, denn »Die kahle Sängerin« war nach seiner Intention ein Stück, das Sinnverlust und ausgehöhlte Sprache ausstellte.
Das hatten bestimmt auch die Punks im Sinn, rund zweieinhalb Jahrzehnte später. Thorsten Weckherlin als Regisseur hat Ionesco die Sex Pistols, The Clash und PIL aufgesetzt, und das funktioniert hervorragend – die Schauspieler glänzen, als Schauspieler und als Punks. Susanne Weckerle und Sabine Weithöner entdecken, in einem berühmten Dialog, wie zufällig, dass sie verheiratet sind: »Welch ein Zusammenspiel! Wie seltsam!« Und Stephan Weber trägt seine verrückt verzweigte Geschichte vom Schnupfen, in der etliche Figuren und Geschehnisse, Verwandtschaftsverhältnisse auf atemlos unsinnige Weise verknüpft sind, in Tübingen glänzend gleich dreimal nacheinander vor, während sich die Dulder auf der Bühne krümmen und die Zuschauer jubeln.
»Die kahle Sängerin« am LTT ist eine großartig befreiende Theatershow. »Und die Moral?« – »Die müssen Sie selber finden.«
Schwäbisches Tagblatt, 21. Juni 2021
(von Dorothee Hermann)
Die kahle Sängerin“ beweist am Landestheater Tübingen, dass das Ionesco-Stück skurrilen Zündstoff für die pandemiestarre Gegenwart bereithält.
Ein Gehäuse, das Rost angesetzt hat, eine Uhr, die ins Leere läuft und doch das unwiederbringliche Vergehen der Zeit markiert: In der aktuellen Inszenierung des Landestheaters Tübingen (LTT) hat der Schauplatz von Eugène Ionescos Theaterstück „Die kahle Sängerin“ den Anschein einer Zeitkapsel in der Endlosschleife.
Die Szenerie zeigt eine Mischung aus einer gewissen, jedoch schäbig gewordenen Wohlsituiertheit und Schrott. Aus zwei paraventähnlichen Hälften zusammengefügt, aber aus dem Material von Knästen, Kriegseinsätzen und anderen Zwangszusammenhängen (Metall, Blech), präsentiert sich die Kulisse mit Stil, aber bewusst unplüschig (Bühne und Kostüme: Vinzenz Hegemann). Die sechs mattgold gestrichenen Stühle zeigen eher verblichene Pracht als shabby chic. Sogar die silbrigen Servierplatten im Regal sehen stark nach Surrogat (Blech, Aluminium) aus – als wäre nur die Vortäuschung von Glanz übriggeblieben. Es ist das Zuhause von Mr. Smith (selbst in Ruheposition scheinbar ständig bebend vor unterdrückter Wut: Gilbert Mieroph) und Mrs. Smith (melancholische Grandezza: Andreas Guglielmetti). Sie ist die Figur, der am stärksten ein Restgefühl für das Tragische des eigenen Zustands geblieben scheint.
Das gilt teilweise auch für Mrs. Martin (leicht irritiert, verletzlich, voller Sehnsüchte: Sabine Weithöner), die zu Besuch kommt. Sie quält die Ambivalenz, ob sie ihren Sinnen und ihren Erinnerungen noch trauen kann oder schon am Durchdrehen ist. Etwas unbeholfen exhibitionistisch, erlebt sie eine doppelte Verunsicherung, als eingespielte Verhaltensmuster (der Verführung) wie auch gewohnte Rollenzuordnungen nicht mehr funktionieren. Da müssen schon kernigere Persönlichkeiten her. Mr. Martin (die verlässliche starke Schulter, aber nur fast: Susanne Weckerle) als Mann von gestern zählt nicht zu ihnen. Er trägt ein dünnes Schnurrbärtchen und sagt: „Vergessen wir alles, was zwischen uns nicht geschehen ist, und leben wir wie zuvor.“
Dass LTT-Intendant Thorsten Weckherlin als Regisseur den Klassiker des absurden Theaters cross-gender besetzt hat und mit Punksongs (Musik: Jörg Wockenfuß) aufgeraut hat, hätte sich Ionesco damals im Jahr 1950 kaum träumen lassen. Doch auf diese Weise gelingt eine funkelnde Aktualisierung, die auch an die nicht nur pandemiebedingte Starre der reicheren Gesellschaften denken lässt – und sie in bizarrer Skurrilität vorführt. Beispielsweise wenn zwei der Figuren, denen man das niemals zugetraut hätte, unvermittelt „No Future“ (1977) von den Sex Pistols schmettern und statt der als langweilig-spießigen erinnerten 1950er Jahre ein England von Massenarbeitslosigkeit und Inflation heraufrufen.
In der ganzen Erstarrung gibt es immer wieder solche kleinen Eruptionen, die aber zu nichts führen, weil sie gleich wieder versickern. Wenn Mr. Smith aufgebracht aufspringt, lassen seine etwas eingeknickten Beine nur die langsamen, zittrigen Schritte eines alten Mannes zu. Einmal schreit er seine Frau an: „Ich kann nicht alles wissen. Ich kann nicht alle deine idiotischen Fragen beantworten.“ Die über den Schuhen getragenen Filzpantoletten verhindern jede spontane, schnelle Bewegung. Deshalb schlurfen die Figuren und scheinen bleischwer am Fußboden zu haften, festgekettet in ihrer kleinen Welt.
Von anderem Kaliber sind das Dienstmädchen Mary (mit revolutionärem Potenzial: Jürgen Herold) und der Feuerwehrhauptmann (Stephan Weber). Auf den ersten Blick ist er der einzige, der dem zu entsprechen scheint, als der er vorgestellt wird. In seiner Gegenwart scheinen die beiden Ehepaare einer ihnen äußerlichen Mechanik unterworfen, als wären sie die Figuren eines Mechanismus, über den nur der Feuerwehrhauptmann die Kontrolle hat. Erst mit seinem Monolog „Der Schnupfen“ wird auch er in die Endlosschleife gesaugt, die die anderen längst gefangen hält.
Unterm Strich:
Lässt Ionescos Klassiker des absurden Theaters durch cross-gender Verfremdungen und punkaffine, exakt pointierte Beigaben funkeln wie neu. Blendet mit dem Sound die 1970er Jahre dazu, als „No Future“ einen ganz anderen Beigeschmack hatte als in Zeiten des sich verschärfenden Klimawandels. Sehr hübsch beobachtet sind auch emotionale Eruptionen, die ins Leere laufen – von der eigenen Bloßstellung abgesehen.