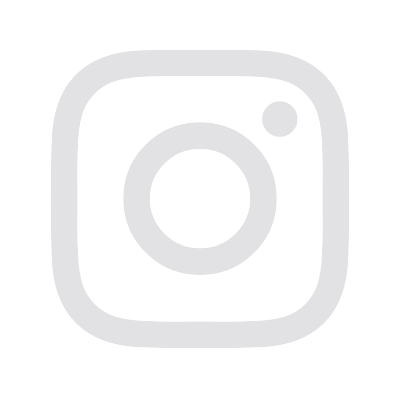Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.















Schauspiel nach dem Roman von Thees Uhlmann in einer Theaterfassung von Hans Schernthaner
Reutlinger Nachrichten, 18. Dezember 2018
Sinnlos, nach Antworten zu suchen
(von Kathrin Kipp)
Wenn der Tod mehrfach klingt: „Sophia, der Tod und ich“ am LTT
Wenn man stirbt, zieht das Leben im Schnelldurchlauf noch einmal an einem vorüber, heißt es. Am Tübinger Landestheater läuft das Leben des Ich-Erzählers in Thees Uhlmanns Roman „Sophia, der Tod und Ich“ rückwärts durch eine Art Flipper-Minigolf-Time-Tunnel-Kreisel-Bahn in gestreifter Retro-Optik und mit irrem Sound- und Lichtspiel, durch eine bunte Todesrutsche, durch ein knalliges „Alles-egal-Areal“ und endet im schwarzen Bällchenbad.
Der Tod hat beim Ich-Erzähler geklingelt, aber als der noch seine drei Minuten Restlaufzeit auskosten will, werden sie gestört durch seine Ex-Freundin Sophia. Was den Tod ziemlich aus dem Konzept bringt. Und so beginnt eine ausgiebige Abschiedstournee zu Mutter und Sohn. Auf dem Todestrip wird viel geschwatzt und diskutiert, der Tod tut dies und der Tod tut das, was jede Menge Wortspiele und Doppelbödigkeiten produziert, zur Belustigung des Publikums, das den Tod (Andreas Guglielmetti) mal von seiner ganz privaten Seite kennenlernen darf. Er ist nämlich nur der „Taxifahrer“ nach drüben. Im Grunde ist dieser Tod ganz freundlich und will nur seinen Job erledigen. Aber auch mal was erleben: „Was machen wir denn morgen Schönes?“. Da gibt es ganz andere, zum Beispiel der zweite Tod (Rinaldo Steller), der eher auf die harte Tour tötet. Im LTT liegt er gerne oben auf dem Todeskreisel, spielt Computerspiele mit historischen Sounds und gurgelt was von „Game Over“. Beide Tode reißen sich um den Ich-Erzähler, es kommt zum Duell: Gewinnt der „gute“ Tod, gibt es noch Hoffung auf eine Art Jenseits, gewinnt der böse, kommen wir alle in die Hölle.
Unter der Regie von Dominik Günther wird die Odyssee über den Styx zu einer sportlichen Angelegenheit. Die Zwangsgemeinschaft im Adidas-Jogging-Dress rödelt sich ab. Es wird gerannt, sich verbogen und kopfüber ins Bällchenbad gesteckt. Auf der Todesreise kommt es zu allen möglichen Familienaufstellungen, der Mangel an echter Handlung im Leben wird kompensiert durch Tratschen, Erinnern und Verrenken. Jürgen Herolds Ich wiederum ist sehr gelenkig, geht aber schon lange nicht mehr aus dem Haus, spielt im Passiv-Fußball die Dramen des Lebens durch und hat das Denken schon längst eingestellt: ein sympathischer Popliteratur-Schnuffi aus den 90ern, dem karrieregeile Zielstrebigkeit und Ich-Optimierung völlig fremd sind. Der allerdings immer ziemlich hektisch am Reden ist, kein Wunder, es bleibt ihm ja auch kaum mehr Zeit. Er holt aber auch noch mal alles raus auf seiner letzten Runde. Seine Ex- und vorübergehende Wieder-Freundin Sophia (Florenze Schüssler) ist eher so der rustikale Typ: insgesamt ist sie vielleicht ganz lieb, meckert aber ständig an ihm rum. Aber das ist Ich schon gewohnt von seiner Mutter, die ihn gerne bloßstellt und mit Generalkritik überzieht. Sabine Weithöner wirkt dabei wunderbar morbide und künstlich wie eine Wachsfigur. Hier kann keiner so richtig mit Gefühlen, außer vielleicht Johnny (John Friedemann Weithöner): „Wer umarmt wird, kann nicht schlagen“. Und so verrenken sich alle und klopfen auf ihre Teller, während der Tod ständig mit seiner Klingel klingelt. Die alte Frage stellt sich: Warum wird überhaupt gestorben? Aber auch dieses Stück ist zwar meistens unterhaltsam, manchmal ein wenig zwanghaft originell und manchmal auch ganz banal, aber längst nicht Gott und weiß deshalb nur: Ohne Tod wär‘s hier ziemlich voll und ziemlich langweilig, weil man gar keine Angst mehr haben müsste, irgendetwas zu verpassen.
Schwäbisches Tagblatt, 4. Dezember 2018
Der Tod hat Urlaub, das Leben klingelt
(von Peter Ertle)
Von Bällebad zu Bällebad, angenehm begleitet von Morten de Sarg: Im LTT hatte Hans Schernthaners Bühnenadaption von Thees Uhlmanns "Sophia, der Tod und ich" Premiere.
Wie aus Loch Ness taucht Ich aus einem Bällebad auf. Ich? Ja, der hat keinen anderen Namen, der heißt so. Bällebad? Ja, Bällebad. "Sophia, der Tod und Ich" ist ein Spiel für große Kinder.
Aber irgendwie ist dieses Bällebad auch ein Grab. Genau genommen ist Ich längst tot. Er hat, sagt er, seit Jahren nicht mehr nachgedacht. Er war seit Monaten nicht mehr joggen. Er versumpft oft in der Kneipe. Kurz: Es handelt sich bei ihm um jene sympathisch verkrachte Existenz, wie aufallenderweise Musiker sie gern beschreiben. Sven Regener zum Beispiel mit seinem Herr Lehmann. Oder eben Thees Uhlmann. Oder wie Aki Kaurismäki es täte - immerhin ein schreibender Freund der Leningrad Cowboys - wenn seine Figuren nicht dem Schweigen, sondern dem Plappern zugeneigt wären. Bei seiner Scheidung hat Ich alles verloren, weil er ohne Anwalt und direkt aus der Kneipe zum Gerichtstermin kam. Seitdem darf er seinen siebenjährigen Sohn nicht mehr sehen, schreibt ihm aber jeden Tag. Und eigentlich klingelt bei ihm zuhause schon lange niemand mehr.
Aber jetzt! Und gleich zweimal! Erst steht der Tod draußen. Den kann nur Andreas Guglielmetti spielen. Zumindest in dieser Mischung aus Eleganz und Tölpelhaftigkeit. Doch dann klingelt seine Ex und brüllt erst mal alles nieder. Im Plan des Tods ist das nicht vorgesehen, irgendetwas scheint schiefgelaufen. Es bedeutet: Aufschub. Die drei brechen auf zu einem Roadtrip, den der verdutzte Tod als unverhofften Urlaub genießt.
"Sophia, der Tod und ich" ist ein Theaterstück nach einem Roman, der sich liest, als hätte Thees Uhlmann alle blitztiefen und plätscherseichten Gedanken, die ihm übers Jahr so einfielen, da reingeschustert und eine skurrile, melancholische, alberne und bisweilen sehr poetische Handlung drumrum gebaut.
Das LTT-Team ließ sich dazu viel schönen Schnickschnack und Geklingel einfallen. Es klingelt und tönt wirklich dauernd. Hängt Ich manchmal am Spielautomaten? Neben dem Bällebad gibt es eine Carrerabahn des Lebens (Bühne: Sandra Fox) mit Looping-Guckloch - für das Regisseur Dominik Günther tolle Gruppenbilder baut. Der Kneipenbesuch artet in grobes Gegröle aus, der Tod und Ich scheißen auf dem Kopf stehend. Zarteres gibt es auch: Der Tod ist perplex, als ihm das Köpfchen der einnickenden Sophia sanft auf die Schulter fällt. Leben ist ja so aufregend!
Mehr soll nicht verraten werden. Außer dass die Mutter (eine Grandmaman-Stilikone: Sabine Weithöner) des Ich Erzählers mit dem Tod sachte anbandelt, allerdings noch ein zweiter Tod im Spiel ist, der mit langen Spiderarmen oder auch mal als Pfändungsbeauftragter nach seinen Opfern greift (und viel Soundtrack beisteuert: Rinaldo Steller), den aber ausgerechnet ein Kind (von wem? Ah: John Friedemann Weithöner. Bravo!) am Ende bezwingt. Oder auch nicht, denn: Ich muss trotzdem hinab ins Bällegrab. Ach! Wenn man das nur immer alles überblicken könnte!
Die Schlüsselrolle für das Kind wundert einen nicht. Sind es doch gerade Ichs Erinnerungen an seine eigene Jugend, die Beschreibung seiner Eltern - und die Gedanken an den eigenen Sohn, die diesem Stück eine wehmütige, schmerzliche und ruhig beseelte Seite verleihen, ein Gegenpart, der das geistreich-spätadoleszente Todesgekasper angenehm erdet und durchdringt. Sagen wir so: Ich (Jürgen Herold) ist ein popliterarisch travestierter Nachhall auf Georg Büchners Leonce. Weshalb wir Sophia (Florenze Schüssler) zu einer Lena erklären. Macht Spaß, ihnen zuzuschauen!
Unterm Strich
Blitztief, plätscherseicht, popliterarisch, melancholisch, poetisch, albern, sentimental: Wer diese Mischung liebt, wird in diesem verrückten Roadtrip mit dem Tod und der Ex-Freundin gut unterhalten. Es klingelt, tönt und piepst beständig. Der heimliche Star des Abends ist ein Kind.
Generalanzeiger Reutlingen, 4. Dezember 2018
(von Thomas Morawitzky)
Thees Uhlmanns »Sophia, der Tod und ich« am LTT wirft actionreich existenzielle Fragen auf
Im Treppenhaus riecht es nicht wirklich nach Kaffee, und der Tod, der Schlaf, der Orgasmus sind ein Schaumbad aus großen schwarzen Blasen. Drinnen liegt Jürgen Herold, die namenlose erste Person in Thees Uhlmanns Roman »Sophia, der Tod und ich«, den dieser vor drei Jahren veröffentlichte. Uhlmann feierte Erfolge mit seiner Band Tomte, späte Protagonisten der Hamburger Schule, machte dann Musik unter eigenem Namen, wandelte sich zum Autor, schweigt seither. Sein Buch führt indes ein munteres Leben auf dem Theater. Die Bühnenfassung von Hans Schernthaner, die in der LTT-Werkstatt gespielt wird, wurde im April 2017 am Altonaer Theater uraufgeführt.
Schwarzwälder Bote, 4. Dezember 2018
Amüsant auf den Punkt gespielt
(von Christoph Holbein)
»Sophia, der Tod und ich« setzt sich witzig mit dem Sterben auseinander
Da hat Regisseur Dominik Günther ganz tief in die Funduskiste der theaterpädagogischen Ideen gegriffen: Die Premiere des Stückes »Sophia, der Tod und ich« nach dem Roman von Thees Uhlmann und in der Bühnenfassung von Hans Schernthaner erweist sich in der Werkstatt des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) als eine zutiefst aberwitzige Auseinandersetzung mit dem Sterben. Das ist flott und grotesk inszeniert und vom bestens aufgelegten Schauspieler-Ensemble auf den Punkt gespielt.
Auf der Tartanbahn des Lebens – Sandra Fox sorgt für ein dynamisch nutzbares Bühnenbild in Spiral- und Laufbahnform, in dem die Protagonisten joggen, sich wälzen, herumspringen, mit schwarzen Plastikbällen werfen und herauf und herunter klettern – ist – mit Musik untermalt – Platz für launige Sprüche: »Nur wer sich siezt, kann sich später duzen.«
Die Geschichte ist skurril: Eines schönen Tages klingelt der Tod an der Tür und sagt dem Ich-Erzähler, dass er nur noch drei Minuten zu leben hat. Im gleichen Augenblick schneit die Ex-Freundin herein: Sophia. Zwischen ihr, dem Tod und dem Erzähler entspinnen sich auf die satirische Spitze getriebene Debatten. Spontan beschließt der Tod, seinen Auftrag nicht sofort zu erfüllen. Und so macht sich das Trio auf eine Reise quer durch Deutschland, denn der Erzähler will sich von seinem Sohn verabschieden, den er seit Jahren nicht gesehen hat, dem er aber jeden Tag eine Postkarte schreibt.
Diesen »Roadtrip« mit dem Tod, der sich Urlaub nimmt, setzt der Regisseur in plastische Bilder um voller Kletterakrobatik der Akteure, Laufspiele und ironische Sprüche: »der Tod, der Schlaf und der Orgasmus – alles eine Familie«. Das ist witzig und schön choreografiert, etwa beim rhythmischen Teller- und Löffelgeklappere. Ein bisschen Slapstick, ein bisschen Comedy, ein bisschen körperliche Dehnübungen und Verrenkungen – fertig ist der komödiantische Comic, tempogeladen und gewürzt mit Pantomime dargeboten. Da fliegen schwarze Plastikbälle, da werden die ausgezogenen und klappernd vor sich hin auf den Boden geworfenen Badeschlappen zum Running Gag. Und schließlich liefern sich der Tod und der auf dessen Job scharfe zweite Tod ein an Computerspiele erinnerndes Duell voller klamaukigem Pathos. Nicht alle Gesten, die Regisseur Dominik Günther in dem furiosen eine Stunde und 35 Minuten langen Spiel ohne Pause setzt, sind für den Zuschauer auf Anhieb zu verstehen. Aber wie lautet doch eine Erkenntnis des amüsanten Abends: »Es ist sinnlos, ständig auf der Suche nach Antworten zu sein.«