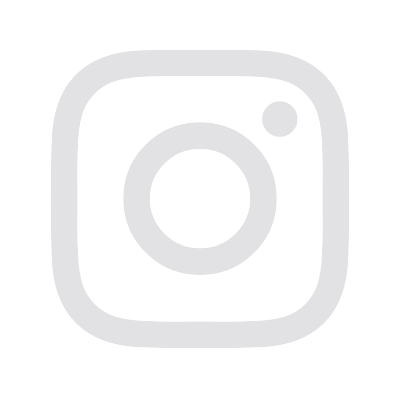Abonnieren Sie unseren WhatsApp Newsletter!
Um zu starten, müssen Sie nur die Nummer +49 1579 2381622 in Ihrem Handy abspeichern und diesem neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start" schicken.















Dramatisches Gedicht von Gotthold Ephraim Lessing
Reutlinger Nachrichten, 6. Oktober 2016
Verbotene Liebe – und das im Pulverfass der Religionen
(von Kathrin Kipp)
Das Landestheater Tübingen Reutlingen eröffnet die Spielzeit mit dem „Stück der Stunde“ – mit Lessings Aufklärungsklassiker „Nathan der Weise“
Verbotene Liebe im multireligiösen Pulverfass: Gotthold Ephraim Lessings aufklärerisches Versöhnungsmärchen hat durchaus seifenoperische Qualitäten. Angesichts dessen, was sich in Deutschland gerade mal wieder an irrationalen Ängsten, „postfaktischem“ Gebrülle und dumpfbackigem Fremdenhass zusammenbraut, setzen die Theater im Land schnell und zahlreich den vernunfts- und diskursfokussierten Nathan auf den Spielplan. Denn der hat schon 1779 lehrbuchmäßig gezeigt, wie man die Fundis ein bisschen ärgern kann, dass (religiöse) Wahrheiten und Wertigkeiten ziemlich relativ sind und wie man interkulturelle Konflikte angehen sollte: mit viel Dialektik, Liebe, Toleranz, Respekt und interreligiösen Verkupplungsmaßnahmen.
Wenn nicht immer wieder die Orthodoxen dazwischenterrorisieren würden. Vor 230 Jahren noch revolutionär, weil nestbeschmutzerisch und kirchenlästerlich, kommt einem das Stück für unsere heutige Lebenswirklichkeit reichlich brav, naiv, schulmeisterlich, religiös, weltfremd und utopisch vor. Beim Zuschauen denkt man die ganze Zeit, die Leute haben Probleme, die sie ohne ihre Religion vermutlich gar nicht hätten.
(...)
Aber immer noch stellt sich die große Frage, ob sich unsere Gesellschaft seit Lessing, oder aber zumindest seit dem Holocaust zivilisatorisch, kulturell, ethisch und ideologisch weiterentwickelt hat.
Deshalb wird dem LTT-Publikum unter der Regie von Oberspielleiter Christoph Roos die aufklärerische Wichtigkeit des Stücks immer wieder mit dem Holzhammer zu Geiste geführt, indem ein „besorgtes“ Volk Pegida- und Nazi-Zitate durch die Gegend brüllt. Von zart fremdenfeindlich bis hin zu übelst rassistischen und antisemitischen Sprüchen aus Gegenwart und Vergangenheit.
Abgesehen von diesen plakativen Geschrei-Einlagen zieht einen der LTT-Nathan als vielleicht nicht gerade lebensecht, aber trotzdem catchy diskursives Stück durchaus mit. Schließlich spielt sich das Ensemble sehr konzentriert, textfokussiert und ohne Effekthascherei, also praktisch ganz trocken evangelisch in die komplizierten Jerusalemer Verhältnisse hinein, die am Ende in eine großartig hanebüchene Seifenoperliebe gipfeln. Diese verbotene Liebe wird dann allerdings nicht mehr durchgespielt, sondern leider aufgelöst. Das war dem guten Lessing dann wohl doch zu unmoralisch.
Auf der LTT-Bühne von Anne Hölck jedenfalls liegen die verkohlten Reste von Nathans niedergebranntem Haus, Nebelschwaden ziehen durch den Saal. Nathan kehrt gerade von einer ausgiebigen Import-Export-Tour zurück und findet nur noch zwei schräge Wände und einen schwarzen Lumpenhaufen vor, durch den sich die Figuren von Zeit zu Zeit wühlen.
(...)
Und so ist das ganze Setting ein einziges Pulverfass: Überall lauern religiöse Tretminen, ein unbedachter Spruch, eine vergessene Leiche im Keller, schon geht es dir an Kopf und Kragen. Alle sind leicht nervös. Der leicht undurchsichtige Sultan beruhigt sich mit Schach, seine Schwester (Franziska Beyer) lässt als Running Gag den Muezzin-Wecker dröhnen. Patrick Schnickes Nathan, dessen gesamte Familie einst von den Christen vernichtet wurde, übt sich in Vernunft, Geduld und Verzeihung - ein Hiob-Typ. Er betrachtet sein Schicksal als Fügung Gottes, während seine temperamentvolle Tochter Recha (Laura Sauer) überall Wunder und Engel sieht, aber auch schon ein wenig in des Vaters Weisheits-Stapfen tritt: „Es sind nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.“ Da hat sie Recht.
(...)
Susanne Weckerle als Rechas Erzieherin Daja erfüllt vor allem eine dramaturgische Funktion, wenn sie die Geheimnisse von Nathan ausplaudert und die Geschichte ins Rollen bringt. Daniel Tille als demütiger Klosterbruder wiederum muss so manchen inneren Konflikt aushalten, während der Finanzminister des Sultans (Robin Walter Dörnemann) die Schnauze voll hat von den ganzen religiösen Brutalitäten und zu den Hindus nach Indien flieht. Ob‘s da menschlicher zugeht? Und überhaupt: Kann uns Religion zu besseren Menschen machen?
Reutlinger Generalanzeiger, 5. Oktober 2016
Humanismus-Utopie mit Störfeuern
(von Christoph B. Ströhle)
Lessings »Nathan der Weise« am LTT. Regisseur Christoph Roos stellt behutsam Zeitbezüge her
Lessings Blankvers trägt noch. Er trägt, wie in der Ringparabel aus »Nathan der Weise«, eine Botschaft, wie sie kaum aktueller sein könnte: Dass die monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam gut daran tun, einander mit unvoreingenommenem Blick als gleichwertig anzuerkennen. Beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in der Dresdner Semperoper trug ein Schauspieler diese Erzählung vor – während draußen eine solchen Gedanken abholde Minderheit pöbelte.
In Tübingen gibt's jetzt den ganzen »Nathan«, inszeniert von Christoph Roos am LTT. Und hier sind die Störmanöver, ob sie nun von Pegida-, IS- oder anderer Seite kommen, in die ansonsten zeitlose Inszenierung eingeflossen. Roos' Ehrfurcht im Umgang mit Gotthold Ephraim Lessings dramatischem Gedicht ist der Aufführung in jeder Szene anzumerken. Als Werk-Zertrümmerer hat sich der LTT-Oberspielleiter bislang ohnehin nicht hervorgetan, eher als Regisseur, der Klassiker behutsam und reflektiert der heutigen Lebenswirklichkeit annähert.
Dennoch lässt er beim »Nathan« die Szenen mehrfach unterbrechen, die Schauspieler gemeinsam oder gegeneinander und stets zum Publikum gerichtet Parolen skandieren, die die Botschaft der Ringparabel und des gesamten »Nathan« mit Abscheu und Hass übertönen. Das Licht ist bei diesen Sequenzen heruntergedimmt, die Stimmen begleitet ein auf Alarm und Krawall getrimmter Klangteppich. So viel Realität neben der Utopie, wie sie Lessing in schönster Sprache ausbreitet, muss dann doch sein. Mit Zertrümmerung hat das nichts zu tun.
Die Einwürfe sind vielmehr ein Störfeuer, das die Gefährdungen jedes Einzelnen deutlich macht, radikalen Parolen und Vorurteilen aufzusitzen. Der Utopie vermögen sie nichts anzuhaben. Zu kostbar erscheint Lessings weltliterarischer, visionärer großer Wurf. Zu sehr tragen Nathan und die übrigen Figuren erfahrenes Leid in sich, das von Gewalt, Verblendung und Unbarmherzigkeit herrührt. Patrick Schnicke macht das in der Rolle des Nathan glaubhaft. Er hat seine Familie verloren, zieht aber nicht die Konsequenz daraus, viel Gewalt mit noch mehr Gewalt zu beantworten. Dass sich am Ende des Stücks herausstellt, dass fast jeder mit jedem verwandt ist, kann man als Weltfremdheit lesen. Oder als nüchterne Erkenntnis, dass – wie in einer Familie – das, was man anderen im Guten wie im Bösen tut, immer mit einem selbst zusammenhängt und auf einen zurückfällt.
Roos findet für das doch eher handlungsarme Ideenstück kraftvolle Bilder. Anne Hölcks Bühnenbild setzt auf einen zum Publikum hin geöffneten Ring als Hauptauftrittsort, zu dem einige Akteure durch ein Meer am Boden liegender Lumpen kriechend und schwimmend gelangen. Als in Glaubensfragen recht liberal denkender Sultan Saladin macht Rolf Kindermann eine gute Figur. Franziska Beyer gibt als seine Schwester Sittah die Skeptikerin, die ihre Erfahrungen vom Schach aufs Leben überträgt.
Laura Sauer als Recha und Heiner Kock als ihr Geliebter/Bruder, der sie aus Nathans brennendem Haus rettet, sind echte Heißsporne, die dem Stück jedwede Betulichkeit nehmen. Susanne Weckerle folgt als Daja bei all ihren Ränkespielen ihrer eigenen Agenda. Sie will Recha und den Tempelherren verkuppeln, weil sie hofft, gemeinsam mit den beiden aus Jerusalem zurück ins christliche Abendland gehen zu können. Daniel Tille verbindet als Klosterbruder einen Mangel an Bildung mit Güte und Lebensklugheit, während Gotthard Sinn als Patriarch von Jerusalem ein seine Macht pompös zur Schau stellender, gerissener Widersacher Saladins und Nathans ist.
Robin Walter Dörnemann gibt als Derwisch Al-Hafi den Emporkömmling und Aussteiger, der als Anhänger der Lehre des Zarathustra eine weitere Religion ins Spiel bringt. Lessing hat diesen Aspekt im Stück allerdings nicht vertieft.
Schwäbisches Tagblatt, 4. Oktober 2016
(von Wilhelm Triebold)
Das Tübinger Landestheater weiß mit Lessings Versöhnungsklassiker recht wenig anzufangen.
(...)
Regisseur Christoph Roos ist kein Freund des womöglich sinnfreien Theaterspektakels, das zeichnet ihn aus. Doch warum er sich jetzt das klassischste aller Toleranzdramen vorgenommen hat, bleibt sein Geheimnis. Dabei zitiert das LTT-Programmheftchen einen möglichen Grund dafür herbei, mit dem klugen Autor Navid Kermani: Heutzutage müsse man, wo Lessings Appell zur Nächstenliebe folgenlos verhallt, weil er längst Allgemeingut geworden ist, solch eine Utopie erstmal negieren, um an sie wieder glauben zu können, "sonst wird sie affirmativ."
(...)
Patrick Schnicke, der aktuelle Nathan, kommt (...) als gelassener, geradezu unerschütterlich in sich ruhender Großmarkthändler daher, mit Kippa, talmudischem Gleichmut und leicht sephardischem Einschlag. Mehr ein Vertreter der praktischen als der reinen Vernunft.
Er kann nicht verstoßen werden, weil er sowieso nicht dazugehört. Als der klamme Potentat Saladin ihm auf den Weisheits-Zahn fühlen will, bewältigt der Prüfling den Mut- und Gewissenstest der "Ringparabel" erst einmal wie ein schüchterner Proband: die schwitzenden Hände auf die Knie gelegt, sich dann allerdings bald freiredend und auch freisprechend.
(...)
Dann skandiert ein Chor mit Macht Antisemitisches (...), streut Pegida-"Perlen" (...) oder stößt Dschihad-Drohungen aus (...).
Am Ende, vorm Blackout (des Bühnenlichts), stehen sie alle ein bisschen ratlos und bedröppelt in der Gegend herum. Keine "stumme Wiederholung allseitiger Umarmung", wie Lessing es vorschlug. Und auch kein Nathan demonstrativ im Abseits. Einfach so: Finito. Du meine Güte, warum auch nicht.
Schwarzwälder Bote, 4. Oktober 2016
Das zähe Ringen um die religiöse Toleranz
(von Christoph Holbein)
Inszenierung von „Nathan der Weise“ müht sich etwas über die Bühne
Die jüngsten Bombenanschläge in Dresden unter anderem auf eine Moschee, die Übergriffe auf Flüchtlingsheime, die fremden- und islamfeindlichen Parolen von Pegida und AfD, der Terror des „Islamischen Staates“ im Namen Gottes, die Attentate in Würzburg und Ansbach, der kriegerische Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern:
Aktuelle Anlässe gibt es genug, die das dramatische Gedicht von Gotthold Ephraim Lessing „Nathan der Weise“ mit seinem Appell für religiöse Toleranz und Menschlichkeit auch heute noch zu einem modernen Stück machen. Ein Stück, welches „das Konfliktpotenzial zwischen Judentum, Christentum und Islam spiegelt und gleichzeitig das Modell einer Versöhnbarkeit von Juden, Christen und Muslimen anbietet“, wie es der Tübinger Professor der katholischen Theologie, Karl-Josef Kuschel, formuliert.
(...) Roos vermittelt in nett gezeichneten inszenatorischen Details einen leisen humorvollen Witz, etwa in der Interpretation der Rolle des Klosterbruders. Kleine Accessoires – wie eine Spieluhr in Sultan-Palast-Form, die arabische Klänge von sich gibt (Anmerkung der Dramaturgie: es handelt sich um einen sogenannten Moscheewecker und um den Ruf des Muezzins) – lockern diese Zähigkeit, dieses mitunter sehr statische Spiel trotzdem zu wenig auf. Und nur sehr zart deutet der Regisseur den aktuellen Bezug des Stückes an: Immer wieder zwischendurch den Chor der Schauspieler im Dunkeln Parolen wie „Wir sind das Volk – es ist nicht das Land von Fremden“ skandieren und am Ende in einer Kakophonie münden zu lassen, reicht da nicht aus. Das sind zu wenige aktuelle Assoziationen. Eindrucksvoller sind da die stillen, kleinen Szenen, in denen die minimalen Facetten gut gezeichnet sind, auf der Suche nach der Wahrheit, die bei Lessing entlang der Ringparabel heißt, dass es nicht den einen, allein selig machenden, rechten Glauben gibt, der die Wahrheit für sich gepachtet hat. Und schon gar nicht das Recht, diese „Wahrheit“ mit Gewalt durchzusetzen, dass es eben nicht legitim ist, für eine „gute Sache“ zu töten.
Gespielt ist die Tübinger Inszenierung gut, wenn auch immer wieder das flotte Agieren, der Drive, der Pep fehlen. Der Regisseur kitzelt dennoch auch Parodie, Ironie und Sarkasmus aus dem Stück, verhilft seinem Ensemble, mit innerer Überzeugung und Energie zu agieren, intensiv zu spielen. Aber ein bisschen mehr Mut beim Kürzen und Streichen nähme ermüdende Längen aus der Inszenierung. Ein bisschen mehr Wagnis, zu experimentieren und Lessings Werk dramaturgisch zu aktualisieren, eröffnete die Möglichkeit, sich auf das Wesentliche des Werks zu konzentrieren, den inhaltlichen Kern zu übersetzen, um damit vor allem auch jüngeres Publikum für diesen gesellschaftspolitisch so wichtigen Stoff zu gewinnen. Das wäre in Zeiten einer wachsenden fremdenfeindlichen Stimmung in unserem Land ein großer Verdienst.